In den dämmrigen Salons des 19. Jahrhunderts, zwischen Dampfmaschinen und ersten mechanischen Rechnern, erkannte eine junge Frau etwas, was uns heute noch beschäftigt. Ada Lovelace, Tochter des Dichters Byron und selbst brillante Mathematikerin, blickte auf die Analytical Engine von Charles Babbage und sah deren Grenzen: Eine Maschine, so genial sie auch konstruiert sein mag, kann niemals etwas wahrhaft Neues aus sich selbst heraus erschaffen. Sie folgt nur den Spuren, die der menschliche Geist für sie gelegt hat.1
Wir leben in einer Zeit, in der Maschinen mehr wissen als jeder Mensch vor uns. Und doch erschaffen sie nichts, was uns wirklich berührt. Warum? Und was bedeutet es eigentlich, wenn eine Maschine kreativ wird?
Die perfekte Imitation
Japan feierte 2016 einen vermeintlichen Durchbruch: Ein computergeschriebener Roman hatte es in die erste Runde eines Literaturpreises geschafft. Doch hinter dem Triumph verbarg sich eine ernüchternde Wahrheit. Achtzig Prozent des Inhalts stammten von Menschen. Die Entwickler hatten den Plot entworfen, Figuren erschaffen, Schlüsselsätze formuliert. Die Maschine fügte zusammen, was andere erdacht hatten. Von eigenständiger Kreation keine Spur.
Zwei Jahre später übersetzte im Experiment »1 the Road« eine sensorbestückte KI während Ross Goodwins Autofahrt die Reise unmittelbar in Literatur. Der Eröffnungssatz klang vielversprechend: »It was nine seventeen in the morning, and the house was heavy.« Was jedoch folgte, war ein Strom aus zusammenhangslosem Kauderwelsch, ein digitaler Fiebertraum ohne narrativen Kompass.
Das Kernproblem: KI kann Wörter aneinanderreihen, aber keinen erzählerischen Bogen spannen. Ohne menschliche Hand, die lenkt und formt, zerfällt jeder längere Text in Fragmente. (Das hindert manche nicht daran, solche Machwerke massenhaft zu produzieren und über Plattformen wie Amazon zu verkaufen.)
Bildgeneratoren wie DALL-E oder Midjourney schaffen mitunter Werke von überraschender Schönheit. Sie durchbrechen Stilgrenzen, erfinden neue Ästhetiken. Textgeneratoren hingegen bleiben trotz ihrer technischen Brillanz literarisch farblos. Sie imitieren, variieren, kombinieren, aber sie erschaffen nicht. Ein Roman, der wirklich fesselt, bleibt Menschenwerk.
Je mehr Daten eine Maschine verarbeitet, desto vorhersagbarer wird sie. Sie wird zum Durchschnitt aller menschlichen Äußerungen, kompetent, aber mittelmäßig. Ein menschlicher Künstler schöpft aus dem Unvollständigen. Aus der Lücke zwischen dem, was er weiß, und dem, was er ahnt. Aus dem Schmerz, nicht alles ausdrücken zu können.
Eine KI hat keinen Schmerz, und damit auch keine Sehnsucht nach dem Unmöglichen. Sie ist der perfekte Archivar, aber sie träumt nicht. Sie kennt keine schlaflosen Nächte, in denen eine Idee geboren wird. Sie hat nie geliebt, nie verloren, nie in einem Moment der Stille plötzlich verstanden.
Kreativität ist nicht das Ergebnis von Wissen, sondern dessen Überwindung. Als Picasso die Regeln der Perspektive brach, tat er das nicht, weil er sie nicht kannte; er kannte sie so gut, dass er ihren Käfig sprengen konnte. Eine KI kennt alle Regeln, aber sie hat nie in einem Käfig gelebt. Sie kann keine Gitter zerbrechen, die sie nie gespürt hat.
KI erzeugt Erstaunliches und bleibt doch kapital unfähig. Sie komponiert, weil Algorithmen ihr zeigten, dass nach einem C-Dur meist bestimmte Akkorde folgen. Sie malt, weil sie aus Millionen Bildern die Wahrscheinlichkeiten von Farbverläufen berechnet hat. Aber sie komponiert nicht, weil Sehnsucht sie überwältigt, und sie malt nicht, weil eine Erinnerung sie nicht loslässt.
Warum wir nie nur kopieren
Man könnte einwenden, dass KI nur verstärkt, was ohnehin geschieht: Menschen wiederholen, was anschlussfähig ist, und so entsteht Kultur. Doch dieser Vergleich übersieht das Wesen menschlicher Wiederholung. Menschen wiederholen nie einfach: sie verwandeln, ohne es zu merken. Im Rokoko trugen die Leute Perücken, die bis zu den Schultern reichten, puderten sich das Gesicht kreideweiß, setzten kleine Schönheitsflecken auf die Wangen. Die Frauen schnürten sich die Taille so eng, dass sie kaum atmen konnten, und bauschten ihre Röcke so weit auf, dass sie seitlich durch keine Tür passten. Was aussah wie Dekadenz, war in Wahrheit eine Revolution gegen die Pracht des Barock. Jede Locke war ein Aufstand gegen die Schwermut ihrer Eltern.
Im Mittelalter verneigte man sich so tief, dass der Kopf fast den Boden berührte. Im 18. Jahrhundert wurde daraus ein Kopfnicken. Heute geben wir uns die Hand oder winken, jede Generation erfand den Gruß neu, ohne es zu merken. Selbst wenn ein Sohn das Handwerk seines Vaters erlernt, macht er es anders. Seine Hände sind anders geformt, sein Rücken ist ebener oder gekrümmter, seine Augen sehen andere Dinge. Jede Wiederholung geht durch den Filter einer einzigartigen Biografie, durch Narben und Erinnerungen, durch das, was dieser Mensch erlebt, geliebt, verloren hat.
KI hingegen extrahiert aus Millionen von Texten statistische Muster, ohne je die Erfahrungen gemacht zu haben, die diese Texte hervorgebracht haben. Sie hat keine Hände, die sich mit den Jahren verändern. Keine Augen, die müde werden. Keine Erinnerungen, die sich mit jedem Abrufen verschieben. Sie reproduziert Muster, aber sie lebt sie nicht. Und ohne Leben gibt es keine wirkliche Veränderung, nur Variation. Was wir heute sehen, ist die Erstarrung dieser Dynamik: Millionen von Menschen erhalten dieselben standardisierten Antworten, und mit jeder Wiederholung wird der Raum für wirkliche Verwandlung kleiner.
Menschliche Kreativität blüht auf, wenn es keine Vorlagen gibt. Unser Geist kann bei Null-Daten-Bedingungen neuartige Konzepte erschaffen, ins Ungewisse vordringen, Regelsysteme de novo entwickeln. Menschliche Intelligenz entsteht in Momenten der Orientierungslosigkeit, wenn keine Anleitung, kein Referenzdatensatz verfügbar ist und Mustererkennung versagt. Künstliche Intelligenz kann das nicht. Sie extrapoliert nur statistische Muster vorhandener Daten, rekombiniert existierende Information.
Echte Kreativität entspringt dem Schmerz, der Freude, der Ahnung von etwas, das noch nie war. Sie braucht das Bewusstsein der Sterblichkeit, der Liebe, des Unvollkommenen. Eine KI erlebt keine Zerrissenheit zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. Ihr fehlt der existenzielle Druck, der Kunst zur Notwendigkeit macht.
Menschliche Kreativität ist der Versuch, das Unsagbare zu sagen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Sie entsteht aus Mangel, dem Wissen, dass die Zeit knapp ist, und dass perfekte Kommunikation unmöglich bleibt. Die Maschine kennt diesen Mangel nicht. Ihr fehlt die heilsame Verzweiflung.

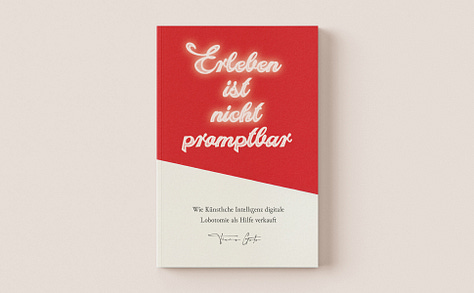
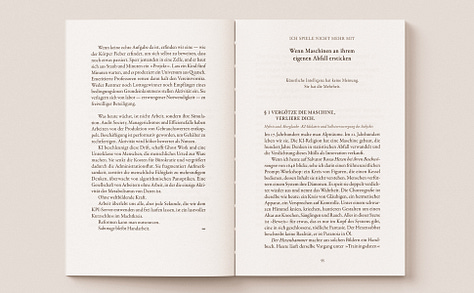
Komplettanalyse:
→ [Amazon-Link/979-8241177346]
Das wortlose Drängen
Wer schreibt, spürt oft ein wortloses Drängen unterhalb klarer Gedanken. Der Psychologe Eugene T. Gendlin nannte dies Felt Sense.2 Es ist kein Gedanke, keine Emotion, sondern ein körperliches Summen, das bereits alles weiß, was gesagt werden soll, aber noch keine Sprache hat. Schriftsteller lauschen diesem Akkord, tasten sich Satz für Satz vor, prüfen am eigenen Leib: Trifft das? Braucht es ein anderes Wort? Sie wissen nicht, was sie suchen, bis sie es gefunden haben. Dann plötzlich, das Einrasten. Der Satz sitzt. So entsteht Literatur, nicht als bloße Reihung gefundener Phrasen.
In den 1970er-Jahren entwickelte Gendlin die Focusing-Methode; ihr Kern ist die achtsame Hinwendung zum schwer in Worte zu fassenden, aber körperlich spürbaren »Gesamt-Aha einer Situation«, dem »dicken Akkord« vor jeder begrifflichen Einordnung.3 Bei erfolgreichem Focusing wird dieses unklare Spüren solange befragt, bis sich eine frische Formulierung einstellt, die genau passt. Entscheidend: Der Felt Sense ist einzigartig; er passt nie ganz in Schubladen, sondern fordert neue Worte.
Schreibforschende haben Gendlins Idee produktiv aufgenommen. Nancy Perl zeigt, dass Studierende lebendiger schreiben, wenn sie sich beim Entwerfen auf ihr leibliches Spürwissen beziehen.4 Ein Lehrprojekt an der City University of New York belegt, dass »Felt-Sense-Check-Ins« kreatives Denken anregen und originelle Formulierungen hervorlocken, die rationales Plotten nicht erzeugt hätte.
Menschliche Kreativität entsteht in der Stille zwischen Leib und Wort, wo das Ungesagte nach Formen sucht und dabei Sprache verwandelt. Sprachmodellen fehlt das vorsprachliche Spürfeld, das Gendlin als Quelle von Neuem beschreibt. Sie können überzeugend imitieren, doch sie generieren ohne leibliche Rückkopplung, die Menschen erkennen lässt, ob eine Formulierung stimmt oder noch ›danebenliegt‹.
Deshalb bleibt KI bei vorhandenen Mustern. Sie findet alles, schnell und gründlich. Aber die Magie beginnt dort, wo meine Geschichte, Wunden, Körpervorgänge und Nichtwissen etwas Unsichtbares ins Sichtbare heben.
Es gibt Menschen, die schreiben wie andere atmen. Das Hypergraphie-Syndrom, wie die Neurologin Alice Flaherty es nennt, treibt sie zum Schreiben wie ein physisches Bedürfnis. Nicht schreiben zu können erzeugt das Gefühl, zu ersticken. Schreiben wird zum Kanal, durch den etwas Größeres in die Welt fließt und ihr Bedeutung verleiht.5 Ich selbst habe Epilepsie, und seit ich vierzehn bin, ist Schreiben das Einzige, was zwischen mir und dem Notausgang steht. Ich schreibe, weil Schreiben der einzige Zustand ist, in dem ich denken kann. Es ist die letzte Arterie, die mich mit dem Leben verbindet. Durchtrenne ich sie, fließt alles Wesentliche aus. Wenn ich schreibe, kämpft mein Gehirn nicht gegen sich selbst.
Das Gehirn ist das beste Sprachmodell, das es je geben wird, denn es ist mit genau den richtigen Daten trainiert: dem eigenen Leben. Je weniger Informationen ich konsumiere, desto geistreicher ist mein Output, desto besser meine Texte. Ich bin so übervoll an Eigenem, dass Input von außen mich von der Quelle abschneidet. Ein Satz, der nicht aus meinem Körper kommt, wirkt wie Gift auf mein Gemüt.
In jenen Salons, wo Ada Lovelace die Grenzen der Maschine erkannte, war die Welt noch überschaubar. Heute bewohnen wir Adas Alptraum: Maschinen, die alles wissen und nichts verstehen, die imitieren, ohne gelebt zu haben. Solange Maschinen das Bekannte perfektionieren, gehört uns das Unbekannte. Solange sie archivieren, was gesagt wurde, bleibt uns das Unsagbare. Unsere Unvollkommenheit ist unser Vorteil. Die Frage ist, ob wir noch den Mut haben, zu scheitern. Denn am Ende entscheiden wir — jedes Mal, wenn wir aufhören zu fühlen, was nur wir fühlen können.
In the twilight salons of the nineteenth century, Ada Lovelace glimpsed a truth that still haunts our digital age: machines do not create; they merely follow the paths already traced by the human mind. This essay argues that, for all their sophistication, artificial intelligences remain fundamentally incapable of genuine creativity. By examining failed AI literary experiments and drawing on Eugene Gendlin’s concept of the »felt sense«, it shows that authentic creation springs from what machines can never possess—embodied experience, the urgency of mortality, and the fertile space between knowing and not knowing. While AI masters pattern recognition and recombination, it lacks the corporeal wisdom and transformative imperfection that animate human expression. As algorithms perfect the predictable, our salvation lies in embracing uncertainty, the unsayable, and the courage to remain beautifully—and necessarily—flawed.Mark Graham, Callum Cant, James Muldoon, »Can Computers Create? A Short History of Mechanized Artistic Ambition«, in: Literary Hub, 12. August 2024.
Eugene T. Gendlin, Making Concepts From Experience, Vortrag auf der International Focusing Conference, Gloucester (MA) 1996, Transkript beim International Focusing Institute. Online abrufbar unter: https://focusing.org/gendlin/docs/gol_2154.html
CUNY COMPosition & Rhetoric Community, »Part One: What is Felt Sense«, Felt Sense Project. Online abrufbar unter: https://compcomm.commons.gc.cuny.edu/feltsense/part-one-what-is-felt-sense
Elizabeth Parfitt, »More Than a Feeling: Finding the ›Felt Sense‹ Through Tutoring«, Blog Another Word (Writing Center, University of Wisconsin–Madison). Online abrufbar unter: https://dept.writing.wisc.edu/blog/more-than-a-feeling
Ed Simon, »Hypergraphia: On Prolific Writers and the Persistent Need to Produce«, in: Literary Hub, 21. Juli 2025.


